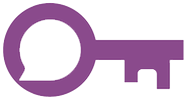Ausbildungsgespräch führen / als Praxisausbildnerin bewusst die Beobachterrolle beibehalten versus eingreifen
Stichwörter:
Situationsbeschreibung: Kontext und Ausgangslage
Die Studierende arbeitet in einer stationären Einrichtung für erwachsene Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen.
Die Situation findet am Mittagstisch mit einer Klientin statt. Vier Bewohner, zwei Bewohnerinnen und zwei Mitarbeiterinnen (Studierende und Praxisausbildnerin) sitzen am Mittagstisch und unterhalten sich. Es ist Mittwoch und wir sprechen über das kommende Wochenende.
Situationsbeschreibung mit Reflection in Action in Handlungssequenzen
Die Studierende unterhält sich mit einer Klientin über das Wochenende. Die PA hört mit und nimmt bewusst die Rolle der Beobachterin ein, ohne dies der Studierenden zu kommunizieren. Die Situation erfordert die ganze Aufmerksamkeit der Studierenden und der PA. Die Herausforderung besteht darin, wirklich nur in der Beobachterrolle zu bleiben und nicht aktiv einzugreifen. Die Studierende teilt der Klientin mit, dass sie am Freitag mit dem Bus zu ihren Eltern gebracht wird und sie das Wochenende bei ihnen verbringen darf.
Die Klientin presst daraufhin ihre lippen zusammen, faltet ihre Hände und schüttelt vehement den Kopf. Nach kurzer Zeit verbalisiert die Klientin ihre Mimik und Gestik und sagt, dass sie nicht nach Hause will. Die Studierende fragt die Klientin, warum sie nicht zu ihren Eltern will. Wieder schüttelt die Klientin den Kopf und sagt erneut „nei, ned hei“. Die Studierende belässt es dabei, fragt und sagt nichts mehr darauf.
Kurze Zeit ist es still. Die Klientin scheint aber immer noch aufgebracht zu sein und fragt in einem aufgeregten, fast ängstlichem Ton immer wieder: „Ned hei, he?“ die Studierende reagiert darauf und spricht sie wiederum darauf an, wieso sie nicht zu ihren Eltern will. Die Klientin reagiert jedoch nicht darauf und fragt immer weiter. Die Studierende zeigt der Klientin auf, dass sie alle zwei Wochen zu ihren Eltern geht und es auch an diesem Wochenende so sein wird. Weiter will die Studierende der Klientin in Erinnerung rufen, dass sie sich eigentlich immer auf die Besuche bei ihren Eltern freut und diese geniesst. Dies scheint die Klientin jedoch nicht wahrzunehmen. Sie geht dann sehr nah zur Studierenden und fragt weiter. Die Studierende versucht daraufhin die Klientin aus dem „Teufelskreis“ heraus zu holen und sagt ihr in einem bestimmten Ton, dass sie damit aufhören soll. Doch auch dies beruhigt die Klientin nicht.
Die Klientin fragt weiter und erst als die Studierende der Klientin mitteilt, dass sie nicht zu ihren Eltern geht, kann sie sich beruhigen. Die Klientin lacht daraufhin und sitzt entspannt und fröhlich beim Mittagessen. Am Wochenende ist die Klientin wie gewohnt nach Hause gegangen.
Die Situation wurde anschliessend in einem Gespräch zwischen der Praxisausbildnerin und der Studierenden besprochen.
Erste Sequenz: Studierende übernimmt aktiv das Gespräch (Gesprächsführung)
Die Studierende spricht die klientin auf das kommende Wochenende an. Sie treten miteinander in Interaktion. Die Praxisbildnerin nimmt sich bewusst zurück und beobachtet die Situation.
Reflection in Action
- Emotion Klient/in: Die Klientin nimmt die Aussage der Studierenden wahr und schaut sie an.
- Der Blickkontakt ist jedoch nicht von langer Dauer, dafür aber oft nacheinander. Die Klientin schaut weg und dann wieder hin. Es scheint ihr in einer gewissen Art unangenehm zu sein. Sei es, weil sie auf dieses Thema nicht vorbereitet war oder dass sie direkt im Mittelpunkt stand.
- Emotion Studierende: Die Studierende wollte mit der Klientin in Kontakt treten. Sie nimmt wahr, dass sie auf sie reagiert und sie immer wieder anschaut. Die Kontaktaufnahme ist ihr gelungen, worüber sich die Studierende freut.
- Emotion Praxisausbildnerin: Die Praxisausbildnerin merkt, dass die Studierende mit der Klientin in Kontakt treten will. Sie klinkt sich daraufhin aus der Situation aus und übernimmt die beobachtende Rolle. Sie bringt sich also nicht aktiv in die Situation mit ein. Dies benötigt Disziplin und Durchhaltewillen. Dabei wirkt sie etwas angespannt und nervös.
- Kognition Studierende: Die Studierende will mit der Klientin in Interaktion treten und sucht ein Thema aus, bei welchem die Klientin mitreden kann. Weiter hat die Studierende die Absicht, dass sie der Klientin damit Freude bereitet.
- Kognition Praxisausbildnerin: Die Praxisausbildnerin hat bemerkt, dass sich die Studierende am Mittagstisch mit den Klienten unterhalten will. Sie hat sich speziell eine Klientin ausgesucht und wollte ihr mit dem Thema eine Freude bereiten.
Zweite Sequenz: Reaktion der Klientin und Intervention der Studierenden
Die Klientin reagiert mit Verneinung und äussert, dass sie am Wochenende nicht nach Hause gehen will. Die Studierende fragt bei der Klientin nach, wieso sie nicht nach Hause gehen will. Die Klientin kann ihr die Frage jedoch nicht beantworten. Die Studierende belässt es dabei.
- Emotion Klientin: Die Klientin scheint verunsichert, angespannt und ängstlich zu sein. Sie fragt die Studierenden immer wieder, ob sie denn nach Hause müsse (ned hei, he?)
- Emotion Studierende: Die Studierende schien überrascht zu sein. Sie rechnete damit, dass sich die Klientin freut. Zudem machte sie einen verunsicherten Eindruck. Sie versuchte durch Schweigen die Situation zu beruhigen. Hierbei sieht man ihr eine Unruhe und Angespanntheit an.
- Emotion Praxisausbildnerin: Die Praxisausbildnerin behält den beobachtenden Status bei. Hierbei verspürt sie eine Angespanntheit und Nervosität. Sie ist hin und her gerissen.
- Kognition Studierende: Die Studierende hat mit einer anderen Reaktion der Klientin gerechnet. Mit der ausgehenden Frage wollte sie ihr Freude bereiten und mit ihr in Kontakt treten. Sie kann sich nicht erklären, wieso sie auf diese Weise reagiert.
- Kognition Praxisausbildnerin: Die Praxisausbildnerin stellte sich die Frage, wieso die Studierende gerade dieses Thema gewählt hat, um mit der Klientin in Kontakt zu treten. Auch deshalb, weil die Klientin ab und zu mit Verneinung und Verunsicherung auf dieses Thema reagiert. Weiter musste sie sich innert kürzester Zeit entscheiden, wie sie vorgehen soll. Sie musste viele verschiedene Dinge berücksichtigen (in eine Situation einmischen, die sie „nichts“ angeht = Autorität untergraben, Studierende sollte eine solche Situation bewältigen können, da sie Klientin schon sehr lange kennt und sie in solchen Situationen auch schon öfters bei der Praxisausbildnerin zuschauen konnte = Lernen am Modell, ist Studierende hilflos oder zu unsicher).
Dritte Sequenz: Aufbau der Krise
DIE KLIENTIN FRAGT, TROTZ SCHWEIGEN DER STUDIERENDEN, IMMER WIEDER, OB SIE NACH HAUSE GEHEN MUSS. DIE STUDIERENDE REAGIERT DARAUF UND FRAGT DIE KLIENTIN NACH DEM GRUND, WIESO SIE NICHT NACH HAUSE GEHEN WILL. DIES KANN SIE WIEDERUM NICHT BEANTWORTEN. DIE STUDIERENDE ZEIGT IHR AUF, DASS SIE REGELMÄSSIG NACH HAUSE GEHE UND DASS SIE SICH IMMER DARÜBER FREUE. AUCH DIESE AUSSAGE HILFT DER KLIENTIN NICHT WEITER UND SIE WIEDERHOLT IMMER WIEDER: „NED HEI, HE?“ DIE STUDIERENDE VERSUCHT DIE KLIENTIN ZU BERUHIGEN, WAS JEDOCH AUCH NICHT FUNKTIONIERT.
- Emotion Klientin: Die Klientin scheint sich im Kreis zu drehen, sie kann sich nicht mehr aus der Situation befreien. Sie scheint ängstlich, fast panisch zu sein.
- Emotion Studierende: Die Studierende scheint hilflos und überfordert zu sein. Auch kann sie die Reaktion der Klientin nicht einordnen, sie hat nicht mit einem solchen Verhalten gerechnet. Es kann sogar sein, dass sie sich allein gelassen gefühlt hat.
- Emotion Praxisausbildnerin: Die Praxisausbildnerin ist in dieser Phase der Situation unsicher und angespannt. Sie ist hin und her gerissen und weiss nicht, ob sie eingreifen soll oder nicht. Sie hat jedoch immer wieder Blickkontakt mit der Studierenden und zeigt ihr so an, dass sie da ist und dass sie eingreifen würde, wenn sich die Situation nicht beruhigen würde. Für die Praxisausbildnerin fuhr die Zerreissprobe fort.
- Kognition Studierende: Die Studierende sucht nach Lösungen, damit sie die Klientin beruhigen kann. Diese scheinen bei der Klientin jedoch keinen Anklang zu finden.
- Kognition Praxisausbildnerin: Die Praxisausbildnerin überlegt sich verschiedene Strategien, wie sie sich in die Situation einbringen kann, ohne die Autorität der Studierenden zu untergraben.
Vierte Sequenz: Bewältigung der Krise
- Emotion Klientin: Die Klientin ist nach der Aussage der Studierenden überglücklich. Sie lacht und isst entspannt ihr Mittagessen.
- Emotion Studierende: Die Studierende scheint erleichtert zu sein, als die Klientin nach der Aussage, dass sie in der Stiftung bleiben kann, zufrieden war.
- Emotion Praxisausbildende: Die Praxisausbildnerin war erleichtert, als sich die Klientin beruhigen konnte und sich die ganze Situation entspannt hat. Jedoch war sie mit der Aussage der Studierenden nicht zufrieden.
- Kognition Studierende: Die Studierende war sich bewusst, dass sie die Klientin angelogen hat.
- Sie wusste jedoch auch, dass sie am Wochenende ohne Probleme nach Hause gehen würde.
- Kognition Praxisausbildnerin: Die Praxisausbildnerin nahm die Aussage der Studierenden zur Kenntnis und sagte in der Situation nichts dazu. Es ist immer ein Abwägen, in welcher Situation zu welchem Lösungsvorschlag gegriffen werden soll. In dieser Situation wären jedoch noch Handlungsalternativen möglich gewesen.
Ressourcen
In der
vorliegenden Schlüsselsituation stehen drei Personen im Vordergrund: die Klientin,
die Studierende, sowie die Praxisausbildnerin. Diese interagieren untereinander
und stehen zueinander in Beziehung. In den nachstehenden Ausführungen wird der Fokus
jedoch hauptsächlich auf die Handlungen der Studierenden und der Praxisausbildnerin
gesetzt.
5.1 Erklärungswissen – Warum handeln die Personen in der Situation so?
5.1.1 Warum haben Menschen ein Bedürfnis nach sozialer Interaktion und Kommunikation?
Jeder Mensch stellt ein eigenständiges Individuum dar, welches gewisse Interessen besitzt. Bestimmte Interessen können jedoch nicht alleine verfolgt und vor allem befriedigt werden. Damit das Bedürfnis trotzdem befriedigt werden kann und somit das Ziel erreicht wird, muss sich das Individuum mit anderen zusammen tun. Diese Wechselwirkung entsteht aus bestimmten Trieben oder Zwecken heraus. Die Triebe und Zwecke, welche die Individuen haben, bedingen somit eine Gemeinschaft oder eine „Gesellschaft“, denn man muss mit anderen Menschen in Kontakt treten, um das Ziel zu erreichen. Die Menschen, mit denen man sich verknüpft, müssen allerdings die gleichen Interessen vertreten. Somit können Menschen gefunden werden, die für dasselbe Ziel kämpfen. Durch diesen Hintergrund entsteht eine Interaktion und damit verbunden eine Kommunikation, denn Interaktion und Kommunikation bedingen sich gegenseitig (vgl. Simmel, 1917).
Die Studierende übernimmt am Mittagstisch die Gesprächsführung. Sie tritt direkt mit einer Klientin inKommunikation. Doch was war die Intention der Studierenden? Wieso sprach sie dieses Thema an. Nach Simmel (1917) handelte die Studierende aus einem Trieb oder Zweck heraus. Die Studierende wollte also eine gewisse Absicht erzielen. Die Absicht lässt sich hier nicht auf den ersten Blick erkennen, denn es handelt sich um eine alltägliche Situation. In dieser Situation spielen auch gesellschaftliche Werte und Verhaltensvorstellungen eine Rolle, die die Studierende in sich trägt. Eine weit verbreitete Vorstellung ist beispielsweise, dass man sich am Mittagstisch unterhält. Es kann daher angenommen werden, dass die Studierende der Klientin eine gewisse gesellschaftliche Norm nahe legen will und ihr aufzeigt, dass es in der heutigen Gesellschaft dazugehört, dass sich Menschen am Tisch unterhalten. Dadurch wird versucht, den Handlungsspielraum der Klientin zu erweitern, sowie die Klientin nach dem Normalisierungsprinzip zu behandeln. Der Zweck der Studierenden wird somit klarer und zeigt auf, dass sie der Klientin handlungskonformes Verhalten mit auf den Weg geben will, damit sie sich in der Gesellschaft besser zurecht finden kann.
5.1.2 Wieso behält die Praxisausbildnerin die beobachtende Rolle bei?
Beobachtung ist ein methodisches Vorgehen, welches in der Sozialforschung häufig genutzt wird. Hierbei geht es nicht nur um die visuelle Wahrnehmung, sondern auch solche, die auf Hören, Fühlen und Riechen beruhen. Es gibt fünf Dimensionen des Beobachtungsverfahrens:
1. Verdeckte versus offene Beobachtung
2. Nicht-teilnehmende versus teilnehmende Beobachtung
3. Systematische versus unsystematische Beobachtung
4. Beobachtung im natürlichen versus unnatürlichem Setting
5. Selbst- versus Fremdbeobachtung
Hinzu kommt, dass der Beobachter oder die Beobachterin in unterschiedlichen Graden am Geschehen teilnehmen kann. Als erstes sind die vollständigen Teilnehmenden zu nennen. Wie der Name sagt, sind diese Teilnehmenden vollständig in das Geschehen eingebunden. Die Teilnehmer- als-Beobachter sind in eine Situation eingebunden, beobachten das Geschehen jedoch zusätzlich. Als dritte Stufe sind die Beobachtenden-als-Teilnehmende zu nennen. Diese sind hauptsächlich zur Beobachtung da, sind aber trotzdem in die Situation mit eingebunden. Als letzte Form werden die vollständigen Beobachtenden genannt. Diese haben Distanz zur beobachteten Situation, damit sie diese nicht beeinflussen (vgl. Flick, 2007).
Da die Situation spontan entsteht, beschliesst die Praxisausbildnerin, dass sie der Studierenden nicht mitteilt, dass sie die Mittagstischsituation mit der Klientin beobachten wird. Die Beobachtung findet somit verdeckt statt und die Studierende, sowie die Klientin wissen nicht, dass sie beobachtet werden. Die Praxisausbildnerin war in eine teilnehmende Beobachtung verwickelt, die sie jedoch unsystematisch beobachtete. Dies, weil der Entschluss zur Beobachtung spontan war und sie sich im Vorhinein keinerlei Vorlagen zur Dokumentation, noch Kriterien zur Beobachtung machen konnte. Die Beobachtung fand jedoch in einem natürlichen Setting statt. Weiter war es eine Fremdbeobachtung, da die Praxisausbildnerin eine Interaktion zwischen einer Klientin und der Studierenden beobachtete. Weiter lässt sich sagen, dass die Praxisausbildnerin als Beobachterin-als-Teilnehmende in das Geschehen eingebunden war. Dies bedeutet, dass sie zwar an der Situation teilhatte, dass sie diese jedoch nicht beeinflusste, da sie sich nicht in das Gespräch eingriff. Dies war der Praxisausbildnerin wichtig, da sie die Situation nicht verfälschen wollte. Die Praxisausbildnerin hätte ihre Rolle als Beobachterin jedoch verlassen, wenn sie gesehen hätte, dass die Studierende mit der Situation überfordert gewesen wäre. Weiter zeigte die Praxisausbildnerin der Studierenden an, dass sie trotz einer anderer Rollenübernahme (Beobachterin) da ist.
Zur weiteren Beantwortung der Frage, wieso die Praxisausbildnerin die beobachtende Rolle beibehält, wird Bezug auf die Theorie „Lernen am Modell“ von Albert Bandura (197) genommen.
Bandura (1979) proklamiert, dass ein Individuum durch die Beobachtung eines anderen Individuums seine Verhaltensweisen verändert oder neue Verhaltensweisen annimmt. Hinter dieser Theorie steckt also ein kognitiver Prozess, welcher die Lernenden (Beobachtenden) durchlaufen müssen. Vier Phasen des Modelles sind dabei von Wichtigkeit:
1. Das Modell (beobachtete Person) benötigt die Aufmerksamkeit der Lernenden
2. Die Lernenden müssen die wichtigsten Elemente der Handlung kodieren
3. Die Verhaltensweise muss vorstellungsmässig reproduziert werden können
4. Durch die positive stellvertretende Verstärkung bzw. Belohnung wird der Lernende die Verhaltensweise nachahmen
Diese Punkte bedingen die Aneignungs-, sowie die Ausführungsphase. Dies bedeutet, dass sich die Lernenden (Beobachtenden) die gewünschte Verhaltensweise aneignen (Identifikation mit dem Modell, Aufmerksamkeit auf Modell gerichtet usw.) und sie danach auch ausführen können (motorische Reproduktions- und Motivationsprozesse).
Da die Studierende bereits seit 2010 in der Stiftung arbeitet und die Verhaltensweisen von der Klientin bekannt sind, hat die Studierende bei vielen verschiedenen Mitarbeitenden gesehen, wie sie in solchen Situationen reagieren. Auch die Praxisausbildnerin hatte schon mehrere solche Situationen durchlebt und sie, in Anwesenheit der Studierenden, gelöst und danach mit der Studierenden besprochen (wieso hat die Praxisausbildnerin so gehandelt und was gäbe es für Alternativen). Die Studierende besitzt also ein breites Repertoire an Lösungsansätzen, die sie sich im Laufe der Zeit, durch Modelllernen, angeeignet hat. In dieser Situation konnte die Praxisausbildnerin der Studierenden zutrauen, dass sie die Situation meistert.
5.1.3 Wie lassen sich Eskalationen/Probleme wahrnehmen?
In diesem Punkt geht es um das Wahrnehmen von bevorstehenden Eskalationen und/oder Problemen. Hierbei wird der Kommunikation, vor allem der nonverbalen Kommunikation, einen hohen Stellenwert eingeräumt. Watzlawick et al. (1969) hat dazu fünf Axiome aufgestellt:
1. Man kann nicht nicht kommunizieren
2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
3. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung
4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten
5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär
Hierbei ist das erste Axiom ein ausschlaggebendes, denn es bedeutet, dass ein Individuum still da sitzen kann und es trotzdem kommuniziert. Das Verhalten des Individuums ist nonverbal, gibt aber Aufschluss über seinen Gemütszustand.
Weiter ist es für das Individuum schwieriger eine nonverbale Kommunikation zu erkennen oder zu verstehen, da diese mehrdeutig . Bei einer nonverbalen Kommunikation bleibt für das Gegenüber viel mehr Interpretationsspielraum offen. Das Augenmerk wird aber besonders dann auf das nonverbale Verhalten gelegt, wenn es darum geht die „wahren“ Absichten zu erkennen (vgl. Ellgring, 1986).
Die Klientin äusserte nonverbale Signale, in dem sie die Lippen zusammen presste, die Hände faltete und den Kopf schüttelte. Diese nonverbalen Signale sind relativ eindeutig und deuten auf eine Verneinung hin. Hinzu kommt, dass die Klientin diese nonverbalen Signale bei solchen Themen öfters sendet. Die Studierende kannte diese nonverbalen Signale bereits und konnte sie sofort einordnen. Weiter kommentierte die Klientin die nonverbalen Signale kurz darauf verbal. Die Studierende konnte durch die nonverbale Kommunikation der Klientin wahrnehmen, dass es kurze Zeit später zu einer Eskalation kommen würde.
5.1.4 Wie lassen sich die Eskalationen/Probleme lösen?
Bei der Theorie „Lernen nach Versuch und Irrtum“ geht es darum, dass Individuen durch Ausprobieren lernen. Hierbei gibt es einen gewissen Reiz (Problem), der eine gewisse Reaktion auslöst. Für ein Problem gibt es immer ein grosses Repertoire an Lösungsversuchen. Beim „Lernen nach Versuch und Irrtum“ finden die Individuen meistens unverhofft eine Lösung. Durch diese positive Überraschung werden die Individuen dazu motiviert, dasselbe Problem noch einmal zu lösen. Die Problemlösung stellt somit eine Verstärkung oder Belohnung dar, wobei der Lösungsweg nicht sofort erkannt wird. Beim zweiten Versuch sieht es jedoch bereits anders aus. Die Individuen schränken die Lösungsansätze ein. Weiter versuchen die Individuen eine geordnete Abfolge von Lösungsschritten zu erlernen, wobei Zwischenzustände zu erreichen sind. Diese Zwischenziele verstärken wiederum das Lernverhalten der Individuen. Die Reiz-Reaktions-Verbindungen werden vor allem erlernt, wenn sie mit Befriedigung verbunden sind oder diese unmittelbar ausgelöst wird. Eine Verbindung wird geschwächt, wenn sie mit negativen Reizen (Unbehagen) verbunden ist (vgl. Steiner und Hermann, 2007).
Die Studierende fing mit einer Klientin ein Gespräch an. Es zeigte sich schnell, dass die Klientin mit der Aussage der Studierenden nicht zufrieden war. Sie reagierte mit Verneinung und teilte der Studierenden mit, dass sie nicht zu ihren Eltern nach Hause will. Dies stellte sich als Reiz oder Problem für die Studierende dar, was in dieser Situation gelöst werden musste. Die Studierende versuchte einen ersten Lösungsansatz, indem sie nachfragte, wieso denn die Klientin nicht zu ihren Eltern will. Die Klientin reagierte darauf wie zu Beginn, schüttelte vehement den Kopf und sagte immer wieder, dass sie nicht nach Hause gehen will. Die Studierende erkannte, dass die Frage nicht den erwünschten Erfolg brachte. Sie versuchte eine neue Lösungsvariante und schwieg. Doch auch dies war nicht die richtige Lösung. Die Klientin wurde nun ängstlich – fast panisch – und die Studierende versuchte es noch einmal mit der Frage, wieso sie denn nicht zu ihren Eltern möchte. Es kam zur gleichen Reaktion der Klientin, wie beim ersten Mal fragen. Die Studierende suchte einen anderen Lösungsweg und zeigte ihr auf und versuchte es mit Erklärungen und dem Aufzeigen, dass sie jedes zweite Wochenende zu ihren Eltern gehe und sie sich auch immer darauf freue. Doch auch dieser Ansatz griff nicht. Die panische Fragerei der Klientin geht weiter, so dass es die Studierende mit einem bestimmten Ton versucht, sie aus dem „Teufelskreis“ heraus zu holen. Auch diese Lösungsvariante nützt nichts. Die Studierende teilt ihr dann mit, dass sie am Wochenende nicht zu ihren Eltern fährt. Daraufhin ist die Klientin beruhigt und sitzt entspannt und fröhlich am Mittagstisch.
Würde man die Theorie „Lernen nach Versuch und Irrtum“ nun strickte anwenden, würde das bedeuten, dass die Studierende der Klientin in solchen Situationen nicht mehr die Wahrheit sagt, denn alle anderen Lösungsansätze haben nicht funktioniert und die Studierende müsste dies nun mit negativer Erfahrung verbinden, was die Reiz-Reaktion-Verbindung schwächt.
Weiter lässt sich in diesem Teil der Arbeit ebenfalls mit der Theorie „Lernen am Modell“ argumentieren. Da diese Theorie jedoch bereits unter Punkt 5.1.2 besprochen wurde, wird sie hier nicht mehr aufgeführt.
Die Studierende wendet in dieser Situation der Eskalation die Theorie „Lernen am Modell“ an. Da sie bereits mehrere dieser Situationen beobachtet hat, hat sie ein gewisses Repertoire an Handlungsspielräumen und kann diese nun anwenden. Da die Klientin auf die Mitarbeitenden unterschiedlich reagiert und unterschiedliche Beziehungen zu ihnen hat, kann es dazu kommen, dass gewisse Lösungsansätze die bei einem Mitarbeitenden greifen, bei der Studierenden nicht funktionieren.
5.2 Interventionswissen – Wie kann ich als professionelle Fachperson handeln?
Als Praxisausbildnerin ist es von Wichtigkeit, dass für die Studierende natürliche Übungssituationen entstehen, die sie in einem geschützten Rahmen machen kann. Dies bedeutet, dass in solchen Situationen immer jemand dabei ist und dass die Studierende Fehler machen darf. Durch solche Übungssituationen kann die Studierende verschiedene Erfahrungen machen und dadurch Lernen. Durch diese Erfahrungen und Lernsituationen werden wiederum verschiedene Strukturen des Verhaltens und Denkens bei der Studierenden aufgebaut. Weiter muss das Problem als lebendig empfunden werden, damit die Studierende die Motivation hat, dieses auch zu lösen. Lebendig bedeutet, dass es das Interesse bei der Studierenden wecken muss. Damit das Problem aber gelöst werden kann, müssen die Praxisausbildenden den Studierenden gewisse Hilfsmittel mit auf den Weg geben (Methoden, Lösungsansätze, Feedback, Reflexion). Die Studierende legt sich im Verlaufe der Zeit ein immer grösseres Repertoire an Verfahren, Methoden und Begriffen zu.
Stellt sich der Studierenden also ein „echtes“ Problem, so ist ihr Interesse geweckt und sie will das Problem lösen. Je neugieriger sie ist, desto tiefer wird das Problem auch angegangen und schliesslich gelöst. Durch das Bearbeiten des Problems entsteht eine immer grösser werdende Einsicht und mit der gefundenen Lösung eine geistige Befriedigung. Durch diesen Erfolg ist die Studierende wieder angespornt weitere Probleme zu lösen (vgl. Aebli, 2011).
Die weitere Aufgabe der Praxisausbildnerin für einen guten Lernprozess der Studierenden ist dass sie so wenig wie möglich, aber so viel als nötig hilft. Denn nur so bleibt das Interesse der Studierenden geweckt und will das Problem selbst lösen. Es ist jedoch wichtig, dass das Problem nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig zu lösen ist. Das Problem muss eine „optimale Passung“ haben. Denn beide Varianten wären für die Studierende wenig motivierend. Weiter soll das Problem von der Studierenden gelöst werden, so lernt die Studierende unterschiedliche Problemtypen zu meistern und die Praxisausbildnerin lernt das Denken und die Lösungsstrategien der Studierenden kennen. Ebenfalls ist die „Arbeitsrückschau“, also eine Reflexion, besonders wichtig. Hierbei geht es darum, dass die Studierende das Problem nicht nur in Einzelteilen, sondern im Grossen und Ganzen sieht. Ist ein Problem tiefgründig gelöst und verstanden worden, so ist die „geistige Beweglichkeit“ grösser. So kann sie in Zukunft die Problemlösung auf ähnliche Situationen anwenden. Aber auch die Planung von Handlungen sollte immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls geändert werden. Auch dazu gehört eine Reflexion zwischen den einzelnen Teilschritten einer Problemlösung (vgl. Aebli, 2011).
Mit der Eskalation des Gesprächs zwischen der Studierenden und der Klientin ist für die Studierende ein Problem aus einer natürlichen Situation entstanden. Das Problem wurde also nicht künstlich „hergestellt“, sondern ergab sich aus einem alltäglichen Geschehen heraus. Die Studierende hat sich dieses Problem sogar selbst gestellt. Die Motivation muss somit gross sein, dieses zu lösen.
Da die Studierende bereits mehrere solche Gespräche mit der Klientin und anderen Mitarbeitenden beobachten konnte und auch darüber in Teamsitzungen und Supervisionen gesprochen wurde, hatte sie verschiedene Verhaltensweisen und Methoden, wie sie die Situation angehen könnte. Weiter wurde sie von der Praxisausbildnerin begleitet, auch wenn diese sich zurückgezogen hat und die Studierende nur so viel als nötig unterstützt hat. Dies zeichnete sich durch die klare Präsenz und den ständigen Blickkontakt mit der Studierenden aus. Es war zu beobachten, dass das Problem für die Studierende nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig war.
Es war zu sehen, dass sich die Studierende verschiedene Lösungsstrategien zurechtgelegt hat und diese auch ausprobierte. Dabei wurde beobachtet, dass die Studierende nicht aufgab, sondern dass sie das Problem anging. Als sie schliesslich zu einer Lösung kam, sah man ihr die Erleichterung an. Es ist anzunehmen, dass sich die Studierende in einer künftig ähnlichen Situation an diese Lerneinheit erinnert und sich der Lösungsstrategien von damals bedient.
Weiter ist erkennbar, dass die Studierende ihr Handeln immer wieder reflektiert und neue Lösungsansätze ausprobiert hat. Am Schluss war ein Gespräch über die Situation mit der Praxisausbildnerin vorhanden.
Weiter muss die Praxisausbildnerin in dieser Situation die Kompetenz besitzen, eine Situation, an der sie selbst beteiligt ist, zu beobachten und sich ein Stück weit aus der Situation zurück zu nehmen. Dies erfordert eine hohe Selbstdisziplin, sowie Geduld. Sie muss auch wissen, wann sie eingreifen muss und wann sie die Situation mit der Studierenden alleine laufen lassen kann. Dies ist für die Praxisausbildnerin nicht ganz einfach und stellt auch eine „Zerreissprobe“ dar.
Selbstverständlich gehört zum professionellen Handeln der Praxisausbildnerin, dass sie sich und Situationen reflektieren kann. Nur wenn die Praxisausbildnerin die Reflexion sehr gut beherrscht, kann sie sie auf andere Situationen und Mitarbeitende übertragen und deren Handlungen und Lösungsansätze nachvollziehen. Falls dies der Fall ist, kann auch eine positive Feedback-Kultur gelebt werden. Unter Feedback-Kultur wird ein regelmässiger Gebrauch von Feedbacks verstanden, welches zur Reflexion und Verbesserung der professionellen Tätigkeit beiträgt. Das Feedback ist eine subjektive Rückmeldung und keine objektive Beurteilung. Somit ist es der Beginn zu einer Diskussion und nicht ein einseitiges Urteil. Die Personen, welche das Feedback geben, müssen sich bewusst sein, dass ihre Beobachtungen durch eigene Wertvorstellungen geprägt sind. Daher ist es von Wichtigkeit, dass die Personen eine Situation, die Aufmerksamkeit ausgelöst hat, wertefrei beschreiben und nicht bewerten. Das Feedback folgt vier Grundpfeilern:
1. Konkrete Beschreibung von Verhalten
2. Trennung von Wahrnehmung und Bewertung
3. Wohlwollende Grundhaltung
4. Rasches Feedback (vgl. Keller, 2005).
5.3 Erfahrungswissen – Woran erinnere ich mich, was kenne ich aus ähnlichen Situationen?
Fakten aus dem eigenen Erleben und dem der Arbeitskolleginnen und -kollegen
Die Klientin zeigt dieses ängstliche, fast panische Verhalten ab und zu. Der Klientin kann es sehr gut gehen und sie kann lachen und erzählen. Fällt ein bestimmtes Wort oder wird sie direkt angesprochen, kann es sein, dass sie derart reagiert. Sie beginnt immer wieder nachzufragen, beginnt zu schreien und zu weinen. Hierbei handelt es sich vor allem um folgende Themen: Arzt, Zahnarzt, Spital, schwimmen und Therapiebad.
Diese Stimmungsschwankungen und das wiederholende Nachfragen zeigt sie bei allen Mitarbeitenden. Es ist aber so, dass sie es bei den einen Mitarbeitenden vermehrt aufzeigt und bei den anderen weniger.
Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, wie mit dieser Situation umgegangen werden kann. Zum einen kann man sie versuchen zu beruhigen, in dem man ihr die Sachlage erklärt (Z. B.: „Du musst nicht zum Zahnarzt, sondern eine andere Klientin“). Diese Strategie nützt, wenn sie wirklich nicht zum Zahnarzt muss. Weiter kann man sie auf ihre Pictos verweisen und diese mit ihr anschauen und besprechen. Meistens lässt sie sich nicht darauf ein und fährt dann mit ihren Fragen weiter. Auch gibt es die Möglichkeit in aller Ruhe die Situation zu erklären. Auch das hilft der Klientin meistens nicht. Ebenfalls kann man in einer bestimmteren Stimme sagen, dass wir es ihr nun erklärt haben und dass sie ruhig sein soll oder wir schicken sie sogar in ihr Zimmer. Eine weitere Variante wäre, dass der andere Mitarbeiter oder die andere Mitarbeiterin eingreifen würde, so dass die Klientin aus dem
„Teufelskreis“ herausgenommen werden könnte.
Die Erfahrung zeigt, dass sich die Klientin vor allem dann beruhigen kann, wenn man ihr nicht die Wahrheit sagt. Also beispielsweise, dass sie nicht zu ihren Eltern gehen muss und sie dann aber trotzdem geht. Hier müssen die Mitarbeitenden abwägen, ob es für die Klientin Sinn macht, dass sie sich aufregt und panische Zustände erreicht oder ob es besser ist, wenn man ihr nicht die Wahrheit sagt und sie dafür ruhig bleiben kann. Vor allem wissen die Mitarbeitenden, dass die Klientin, wenn es soweit ist, sehr gerne zu ihren Eltern geht. Hier müssen die Mitarbeitenden abschätzen, was für die Klientin mehr Lebensqualität bedeutet.
5.4 Organisations- und Kontextwissen – Welche Rahmenbedingungen beeinflussen mein Handeln?
Die Stiftung hat seit September 2014 ein neues Leitbild. Hier vermittelt sie allen Mitarbeitenden der Stiftung, welches den Auftrag der Organisation darstellt.
Unsere Vision:
- Wir schaffen Lebensqualität für Menschen mit Beeinträchtigungen.
Unsere Mission:
- Wir sind der führende Anbieter für umfassende sonderpädagogische Leistungen im Kanton Aargau. Wir verfügen über herausragende sonderpädagogische Kompetenzen und eine hohe Dienstleistungsorientierung.
- Wir übernehmen Verantwortung für unsere Entscheide, handeln nach unternehmerischen Grundsätzen und zeichnen uns durch Qualität und Effizienz aus.
- Wir handeln achtsam und respektvoll gegenüber allen unseren Anspruchsgruppen.
Unsere Werte:
- Kompetenz ist unsere starke Basis.
- Innovation sichert die Leistungen von morgen.
- Verantwortung schafft nachhaltige Werte
Unsere Leitsätze:
- Wir zeichnen uns durch Kompetenz, Qualität, Respekt und Zusammenarbeit aus.
- Unser Handeln bezieht Werte, Haltungen und Trends in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ein.
- Alle Aktivitäten und ihre systematische Umsetzung basieren auf den Elementen der Nachhaltigkeit.
- Allen Anspruchsgruppen begegnen wir verantwortungsbewusst und wertschätzend.
- Als zuverlässige Partnerin engagieren wir uns wirkungsvoll in Gesellschaft und Politik.
- Unsere Arbeit ist geprägt von Selbstverantwortung, Engagement und Fokussierung.
- Wir bilden uns kontinuierlich weiter und reflektieren unser Handeln.
- Fachwissen wenden wir unter Einbezug der Erfahrungen aus der Praxis an. (vgl. Leitbild der S. S., 2014)
Dieses Leitbild beeinflusst die Handlungen der Mitarbeitenden insofern, dass sie sich daran orientieren. Der Hauptgedanke für die Arbeit wird in der Vision sehr schön zusammengefasst. „Wir schaffen Lebensqualität für Menschen mit Beeinträchtigung.“ Und dies ist auch der Leitgedanke für unser Team. Das Klientel steht im Mittelpunkt und es wird so gearbeitet, dass dieser Gedanke auch eingehalten wird. Dies bedeutet, dass individuell auf das Klientel eingegangen wird und dass sie gefördert, aber nicht überfordert werden.
5.5 Fähigkeiten – Was muss ich als professionelle Fachperson können?
Eine erste wichtige Fähigkeit ist, dass man empathisch sein muss. Ohne die Empathie könnte man auf keinerlei Menschen eingehen, was für diesen Beruf elementar ist. So kann man sich in andere Menschen hineinversetzen, Handlungen nachvollziehen und auf sie reagieren. Mit der Empathie ist ebenfalls die Kongruenz der Mitarbeitenden verbunden. Dies bedeutet, dass man „echt“ sein muss. Das erleichtert dem Klientel das Gegenüber richtig und nicht verfälscht zu verstehen.
Hinzu kommt, dass man als professionelle Fachperson eine gute Wahrnehmungs- und Beobachtungsgabe haben muss. Dadurch lassen sich unauffällige Dinge wahrnehmen, die zu einem wichtigen Meilenstein gehören können.
Zur Wahrnehmungs- und Beobachtungsgabe gehört natürlich die nonverbale Kommunikation dazu. Für diese müssen die Mitarbeitenden sensibilisiert sein. Nicht nur, weil sie von enormer Wichtigkeit ist, sondern auch darum, weil sich vor allem Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht immer verbal äussern können.
Weiter muss eine professionelle Fachperson klar und verständlich kommunizieren können. Die nonverbale und verbale Kommunikation muss somit übereinstimmen, was ebenfalls wieder mit der Kongruenz zusammenhängt.
Natürlich darf die Reflexionsfähigkeit einer professionellen Fachperson nicht fehlen. Nur wer sich und seine Handlungen reflektieren kann, lernt daraus und kann in künftig ähnlichen Situationen vom Handlungsrepertoire Gebrauch machen. Die Reflexion soll zum Nachdenken anregen und die Handlung soll mit anderen Mitarbeitenden angeschaut werden. Nur so lässt sich eine Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Handlungsstrategien herstellen.
Mit letzterem Punkt hängt auch das Feedback zusammen. Es ist wichtig, dass eine professionelle Fachkraft den Mitarbeitenden eine positive Feedback-Kultur vermittelt und diese auslebt.
5.6 Organisationale, infrastrukturelle, zeitliche, materielle Voraussetzungen – Womit kann ich handeln?
- Ein Mal in der Woche hat die Gruppe Teamsitzung à zwei Stunden, in der das Team klientenspezifische Themen anschauen kann.
- Sechs Stunden werden dem Team für andragogische Praxisberatungen zur Verfügung gestellt. Hierbei geht es darum, dass wir gewisse Verhaltensweisen von Klientinnen und Klienten analysieren und so zu neuen Lösungsstrategien gelangen.
- Weitere sechs Stunden stehen in Supervisionen für die Teamarbeit zur Verfügung.
- Für die Praxisausbildungsgespräche mit der Studierenden stehen pro Monat ca. vier Stunden zur Verfügung.
5.7 Wertewissen – Woraufhin richte ich mein Handeln aus? Welches sind die zentralen Werte in dieser Situation, die ich als handelnde Fachperson berücksichtigen will?
- Der Studierenden wird Verantwortung zugesprochen.
- Die Studierende soll Verantwortung übernehmen.
- Die Studierende darf in einem geschützten Arbeitsfeld Fehler machen und daraus lernen. Die Fehlerkultur wird auf der Gruppe gelebt, was bedeutet, dass Fehler toleriert werden.
- Es ist jedoch wichtig, dass offen mit diesen Fehlern oder vielmehr Problemen umgegangen wird, denn nur so können ein gegenseitiger Austausch und ein gegenseitiges Lernen stattfinden.
- Die Fehlerkultur ist dem ganzen Team bekannt. Dies wurde an einer Supervision thematisiert.
- Das Wohl der Klienten und Klientinnen steht im Vordergrund und dies soll selbstverständlich nicht durch die „Fehler“ der Mitarbeitenden „leiden“. Das bedeutet, dass ein anderer Mitarbeiter oder eine andere Mitarbeiterin sofort eingreifen müsste, wenn der Fehler zu grob wäre oder bei den Klienten und Klientinnen Unbehagen und Unsicherheiten auftreten würde
Reflexion anhand der Qualitätsstandards
Allgemeine Standards
- Erwartungen im Spannungsfeld Hochschule, Praxisausbildungsplatz, PA, Studierenden sind geklärt: Die Erwartungen wurden zu Beginn des Studiums geklärt und werden in den Standortgesprächen thematisiert.
- Kooperationsbereitschaft zwischen Studierenden und PA bleibt bestehen (wertschätzend): Die Kooperationsbereitschaft bleibt weiterhin bestehen
- Arbeitsbündnis ist hergestellt bzw. bleibt bestehen, ist gefestigt: Das Arbeitsbündnis besteht schon über eine längere Zeit und wird bestehen bleiben.
- Reflexionsfähigkeit ist gefördert: Die Studierende wird immerzu angehalten eigene und fremde Situationen zu reflektieren.
- PA nimmt ihre Verantwortung als Gestalterin der Lernprozesse wahr: Die PA war sich der Situation bewusst und erkannte sie als Lernfeld für die Studierende.
- Verantwortlichkeiten der Beteiligten sind geklärt: Der Studierenden ist bewusst, dass sie Verantwortung trägt, dass die PA aber die Gesamtsituation verantwortet.
Spezifische Standards
- Lernsituationen schaffen, die die Studierende dazu motivieren, sie selbstständig zu lösen: Dieser Standard wurde eingehalten, wobei die Lernsituation durch die Studierende selbst zu Stande kam. Die Lernsituation wurde durch die Praxisausbildnerin als solche erkannt.
- Lernsituationen begleiten: Die entsprechenden Situationen wurde durch die Praxisausbildnerin begleitet.
- Fehlerkultur in geschütztem Rahmen ist erwünscht: Die Studierende hat nicht von Anfang an die „richtige“ Lösung angewendet. Sie hat „Fehler“ begangen.
- Unterschiedliche Lösungen anwenden: Die Studierende musste verschiedene Lösungen ausprobieren bis sie das Ziel erreichte, dass die Klientin wieder sicher war und sich beruhigt hat.
- Problem wurde am Ende gelöst: Das Problem wurde von der Studierenden alleine gelöst. Sie musste zwar über Umwege gehen, indem sie immer wieder neue Lösungswege einschlug.
- Reflexion und Austausch über das Problem: Die Studierende hat sich darüber Gedanken gemacht, wie sie die Situation noch anders hätte lösen können. Dies äusserte sie auch der Praxisausbildnerin gegenüber. Auch war der Austausch mit der Praxisausbildnerin da. Im Team wurde jedoch nicht darüber gesprochen. Dies könnte man bei einem nächsten Mal in Betracht ziehen. Da es aber keinen schwerwiegenden Fehler ist, war es in dieser Situation nicht von Nöten.
- Sicherheit für das Klientel herstellen (Wohl der Klienten und Klientinnen an erster Stelle): An erster Stelle steht immer das Wohl der Klienten und Klientinnen. Dies muss unbedingt befolgt werden. Die anderen Mitarbeitenden müssten bei einer Verletzung des Wohls eingreifen. Daher wurde die Situation von der Praxisausbildnerin sehr genau beobachtet. Weiter gab sie sowohl der Studierenden, sowie dem Klientel mit ihrer Präsenz zu verstehen, dass sie nicht alleine sind.
Handlungsalternativen
- Im Nachhinein hätte die Studierende die Situation mit der Klientin noch einmal besprechen können.
- Als es soweit war und die Klientin mit dem Bus zu ihren Eltern fuhr, hätte man sie daran erinnern können, dass es nicht so schlimm sei, wie sie es vor einigen Tagen gesagt hat.
- Die Situation sollte an einer Teamsitzung und/oder andragogischen Praxisberatung besprochen werden, so dass man dem Grund für dieses Verhalten der Klientin auf den Grund kommt.
- Es sollte herausgefunden werden, wieso die Klientin auf gewisse Sachen mit einer solchen Angst und Panik reagiert.
Literatur
- Aebli, Hans (2011): Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik aus psychologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus. Stuttgart: Klett-Cotta
- Bandura, Albert (1977): Social learning theory. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall. Dt. Sozialkognitive Lerntheorie. Stuttgart: Klett-Cotta
- Ellgring, Heiner (1986): “Nonverbale Kommunikation.” Körpersprache in der schulischen Erziehung (S. 7-48). Baltmannsweiler: Pädagogischer Verlag Burgbücherei Schneider GmbH
- Flick, Uwe (2007): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag
- Keller, Hans (2005): Aufbau und Elemente einer Feedbackkultur. Zürich: Verlag Impulse
- Simmel, Georg (1917): Grundfragen der Soziologie. Individuum und Gesellschaft. Berlin und Leipzig: G. J. Göschen’sche Verlagshandlung GmbH (Sammlung Göschen, Bd.101)
- Steiner, Gerhard und Hermann, Joachim (2007): Lernen. 20 Szenarien aus dem Alltag. The World Fair`s Nails – Lernen nach Versuch und Irrtum? (S. 36-50). Bern: Verlag Hans Huber
- Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H., Jackson, Don D. (1969): Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien. Bern, Huber (12. unveränd. Aufl. 2011)
- Leitbild der S. S. (2014)